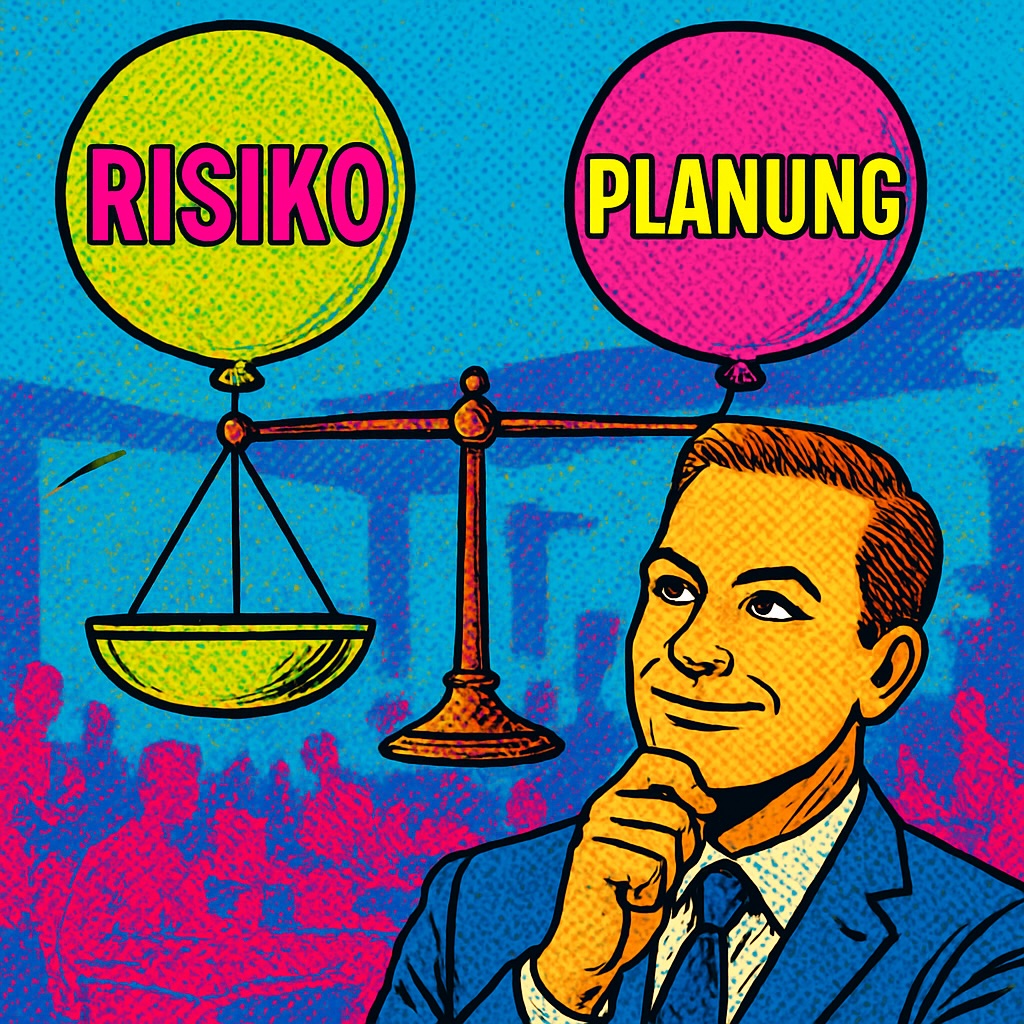Vertraglich abgesicherte Planung & Stornorisiko‑Management für KMU inklusive Checkliste für Ihre Meetings
Warum vertragliche Planungsschutz jetzt unverzichtbar ist
In wirtschaftlich unsicheren Zeiten (Trumps Zoll-Schaukel, Suez Kanal, Corona-Verwerfungen, Krisen-Einflüsse) reicht es nicht mehr aus, sich auf volle Auftragsbücher zu verlassen.
Was auf den ersten Blick nach stabiler Auslastung aussieht, kann sich innerhalb kürzester Zeit in ein akutes Risikopotenzial verwandeln, wenn die zugrunde liegende Planung nicht ausreichend vertraglich abgesichert ist. Immer häufiger begegnen mir in meiner Beratungspraxis Fälle, in denen mittelständische Unternehmen Produktionen starten, Materialien einkaufen oder Personalressourcen binden, ohne dass ENTWEDER ein rechtsverbindlicher Auftrag mit ABGESICHERTER ZAHLUNG oder ein WORST-CASE-PLAN vorliegt. Das Ergebnis: enorme Risiken für Liquidität, Lieferkette und Unternehmensstabilität.
EINWAND: Aber wenn ich das versuche, bin ich nicht mehr Wettbewerbsfähig!
Wenn Sie dieser Gedanke umtreibt, senden Sie mir bitte eine persönliche Nachricht.

Nachdem eein Unternehmen durch unzureichende Planung in die Insolvenz getrieben wurde, gibt Urs Altmannsberger hier Tipps, wie sie als Unternehmer, Einkaufsleiter und Verkaufsleiter so planen, dass selbst im widrigen Fall das Unternehmen nicht gefährdet wird und sicher Gewinne erwirtschaftet werden.
In jedem funktionierenden Unternehmen findet eine intensive Abstimmung zwischen Planung, Einkauf, Produktion und Vertrieb statt. Doch diese Abstimmung allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, dass die unternehmensinterne Planung, von der Bedarfsprognose bis zur Fertigung, eng an die vertragliche Realität mit dem Kunden gekoppelt ist.
Meine Kunden berichten immer wieder, dass gerade dieser Aspekt in der Vergangenheit zu Unsicherheiten und Fehlentscheidungen geführt hat. So wurden Halbfertigerzeugnisse produziert oder Rohstoffe beschafft, obwohl noch keine endgültige Zusage des Kunden vorlag.
Die drohende Folge ist klar: Kapitalbindung, Lagerkosten und das Risiko, auf Produkten sitzen zu bleiben, wenn der Kunde später aufgrund einer Krise storniert oder sich ganz zurückzieht.
Ein zentraler Punkt, den ich in meinen Trainings und Beratungen immer wieder betone, ist die konsequente Integration von Storno-Risiken in die operative Planung.
Die Frage „Was machen wir, wenn der Kunde storniert?“ darf nicht erst am Tag des Rücktritts gestellt werden – sie muss bereits in der frühesten Planungsphase beantwortet sein. Dies beinhaltet klare Antworten auf folgende Fragen:
- Welche Kosten sind bis zum Zeitpunkt der Stornierung angefallen?
2. Was passiert mit bereits produzierten Halbfertigwaren?
3. Welche Vereinbarungen existieren im Vertrag zur Rücknahme oder Vergütung?
4. Welche finanziellen Reserven wurden für den Fall einer Stornierung einkalkuliert?
Ein Unternehmen aus dem Maschinenbau (Zulieferant u. a. der Automotive Branche), das ich seit mehreren Jahren begleite, stand vor genau dieser Herausforderung. Ein Großkunde stornierte kurzfristig einen Auftrag in Millionenhöhe. In der Vergangenheit hätte das das Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Doch durch die Einführung eines Stornorisiko-Fonds [eine Rücklagenbildung, die wir gemeinsam definiert hatten] konnte der Verlust abgefedert werden.
Grundlage dieser Strategie war die bewusste Entscheidung, bei bestimmten Kunden bewusst ein höheres Risiko einzugehen, dies aber durch Finanzmittel abzusichern, die nicht ins operative Geschäft einfließen. Diese Strategie verleiht Handlungssicherheit ohne operative Panik.
Zugrunde liegt dieser Herangehensweise das Harvard-Konzept, das nicht Positionen, sondern Interessen verhandelt. In der Zusammenarbeit mit Kunden wird so frühzeitig herausgearbeitet, welche Interessen hinter einem Auftrag stehen: Beim eigenen Unternehmen, aber auch auf Kundenseite.
Maßnahmen: Stornorisiko‑Fonds & Frühwarnsysteme
Wer weiß, dass ein Kunde besonders auf Flexibilität oder schnelle Reaktionsfähigkeit angewiesen ist, kann gezielt Bedingungen verhandeln, die eine Stornierung abfedern oder vertraglich finanziell kompensieren. Kunden, die verlässliche Lieferanten suchen, sind durchaus bereit, für Planungssicherheit eine MIT-Verantwortung zu übernehmen, wenn wir das Thema früh genug auf den Verhandlungstisch bringt. Das insbesondere dann der Fall, wenn sich der Kunde bereits über Lieferketten Sicherheit in den vergangenen Krisen zwangsweise Gedanken machen musste. Oftmals wird dieser Punkt jedoch gar nicht auf den Verhandlungstisch gebracht und ist damit von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Altmannsbergers Tipp: Gehen Sie davon aus, dass nach den Krisenjahren ganz andere Offenheit für die Diskussion von Absicherungen der Lieferkette gegeben sind
In meiner Beratungspraxis implementieren wir regelmäßig Frühwarnsysteme, die kritische Phasen in der Vertragsentwicklung signalisieren. Kommt es zu Verzögerungen, offenen Punkten oder unklarer Kommunikation, greift ein Eskalationsprozess: Verhandlungen werden intensiviert, interne Maßnahmen gestoppt oder neu priorisiert. So bleibt das Unternehmen handlungsfähig und kann Investitionen oder Beschaffungen auf verlässlicher Entscheidungsgrundlage tätigen.
Hinweis in eigener und Ihrer Sache: Dieser Bericht ist Teil meiner mein Verhandler-Tipps, die ich regelmäßig an Entscheider und Einkaufsleiter versende. Er greift genau solche Fragen aus der Praxis auf. Er liefert kompakte Impulse, wie man komplexe Planungs- und Vertragsthemen strukturiert angeht, welche Formulierungen sich bewährt haben und welche Methoden Risiken frühzeitig sichtbar machen. Senden Sie mir eine Nachricht, und ich werde Sie in den Verteiler aufnehmen.
Planungssicherheit beginnt nicht bei der Produktionsfreigabe, sondern beim Vertragsentwurf. Nur Unternehmer, die interne Abläufe mit vertraglicher Klarheit synchronisieren, können sich auf externe Zusagen verlassen, sicher einkaufen, effizient produzieren und schlank kalkulieren.
Risiken gehören zum Geschäft!
Die Erfahrung aus zahlreichen Projekten zeigt: Es geht nicht darum, alle Risiken zu vermeiden, sondern sie zu kennen, zu beziffern und gezielt abzusichern. Wer das tut, stärkt nicht nur seine Verhandlungsmacht, sondern vor allem seine unternehmerische Zukunft.
Was ist Stornorisiko und wie entsteht es?
Insolvenzrisiken erkennen, absichern und durch kluge Vertragsgestaltung vermeiden
In den letzten Monaten häufen sich die Nachrichten über Insolvenzen (Anlass für diesen Beitrag ist die Nachricht in der Tagesschau [Stand 25.7. war das hier zu lesen, ich weiß nicht, wie lange der Link funktioniert, https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/insolvenzen-mittelstand-vulkan-stuertz-100.html] selbst bei wirtschaftlich erfolgreichen mittelständischen Unternehmen. Ein besonders aufrüttelndes Beispiel ist die Insolvenz eines großen Maschinenbauers aus Rheinland-Pfalz, der trotz voller Auftragsbücher bis weit ins kommende Jahr Insolvenz anmelden musste. Die Ursachen liegen häufig nicht in der mangelnden Nachfrage, sondern in unzureichender vertraglicher Absicherung und fehlender Risikobewertung innerhalb der Wertschöpfungskette.
In meiner täglichen Arbeit mit Einkaufs- und Geschäftsleitungen zeigt sich immer wieder: Die Verbindung zwischen interner Produktionsplanung, Einkauf und der Vertragsgestaltung zum Kunden ist in vielen Unternehmen nicht durchgängig und belastbar abgestimmt. Genau hier liegt jedoch eine der zentralen Stellschrauben zur Vermeidung von Unternehmensrisiken, insbesondere im Hinblick auf Liquidität und Lieferfähigkeit.
Harvard-Konzept und Risikoverhandlung mit Kunden
Ein Praxisbeispiel aus einem Automobilzulieferbetrieb zeigt das sehr eindrücklich: Ein mittelständisches Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitenden plante die Produktion einer Spezialkomponente für einen OEM, obwohl die finale vertragliche Beauftragung noch ausstand. Auf meinen Hinweis hin wurde eine Risikoanalyse durchgeführt und auf Basis des Harvard-Konzepts eine Best-Alternative-To-a-Negotiated-Agreement (BATNA) samt Worst-Case-Szenario erarbeitet. Es wurde schließlich vereinbart, dass die Produktion erst nach Eingang einer verbindlichen Bestellung mit fest vereinbartem Abnahmeplan startet. Das Unternehmen vermied dadurch eine potenzielle Fehlinvestition im siebenstelligen Bereich.
Wer sich durch vermeintlich entscheidenden Druck des Einkaufs seines Kunden zu anderen Aussagen pressen lässt, löst den Splint an der kaufmännischen Granate.
In meinen Verhandlungstrainings legen wir genau auf diese Praxis großen Wert:
- Welche Informationen braucht ein Einkauf, um sauber und risikobewusst zu entscheiden?
- Wie lassen sich Interessen frühzeitig abgleichen und so gestalten, dass Lieferkette, Produktionsplanungund Auftragssicherheit zusammenpassen?
Ein weiteres Beispiel stammt aus der Konsumgüterbranche. Hier haben wir einen Eskalationsprozess definiert, der automatisch bei Abweichung zwischen geplanter Beschaffung und tatsächlicher Auftragslage greift.
Der eigene Einkauf transferiert das Risiko aus dem Unternehmen heraus und verlagert oder verteilt es auf die gesamte Lieferkette.
Dabei wurde gemeinsam mit dem Kunden ein Frühwarnsystem etabliert, das mit klaren Eskalationsstufen arbeitet. Ist beispielsweise ein Kundenauftrag zwar angekündigt, aber noch nicht vertraglich abgesichert, wird die Beschaffung in Teillosen und mit Rücktrittsklauseln durchgeführt. Dieses Vorgehen hat dem Kunden nicht nur finanzielle Flexibilität bewahrt, sondern auch die interne Kommunikation zwischen Vertrieb, Einkauf und Geschäftsführung nachhaltig verbessert.
Im Rahmen unserer Strategie-Diskussion erarbeiten wir regelmäßig solche unternehmensspezifischen Frühwarn- und Absicherungsmodelle. Sie stärken die Verhandlungsmacht des Unternehmens gegenüber Kunden und Lieferanten gleichermaßen und schaffen eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Zentral ist dabei immer die Frage: Was passiert, wenn der Auftrag ausfällt?
Ein professionell aufgestelltes Unternehmen muss in der Lage sein, Alternativen zu formulieren, Restverwertungen zu kalkulieren oder Kompensationen einzufordern.
Dies gelingt nur dann, wenn solche Szenarien im Vorfeld verhandelt und dokumentiert wurden. Besonders hilfreich ist dabei die strukturierte Interessenanalyse, wie sie im Harvard-Konzept verankert ist. Nicht Positionen stehen im Vordergrund, sondern die dahinterliegenden Interessen, sei es Planungssicherheit, Liquiditätsverfügbarkeit oder die Fähigkeit zur flexiblen Ressourcennutzung.
Worst‑Case-Szenarien erkennen
In der Praxis bedeutet das: Unternehmen sollten bereits in der Verhandlungsphase mit dem Kunden regeln, was mit Halbfertigwaren oder spezifisch beschafften Rohstoffen geschieht, wenn ein Projekt storniert wird. Übernahmeverpflichtungen, Rücknahmeregelungen oder Zahlungsausgleichsklauseln sind nur einige der Instrumente, die dabei genutzt werden können.
Ein mittelständischer Maschinenbauer, den ich regelmäßig begleite, konnte durch die Einführung eines neuen Verhandlungsformats große Risiken abfedern. Dabei wurde eine Matrix entwickelt, die Vertragsklarheit mit Einkaufsfreigaben verknüpft. Erst wenn der Kundenauftrag bestimmte Kriterien erfüllt (z. B. schriftlich bestätigt, Zahlungsmodalitäten geklärt, verbindliche Abnahmemenge vereinbart), erfolgt die interne Produktionsfreigabe. Dieses System wurde zusätzlich durch einen monatlichen „Verhandlungspuls“ ergänzt, ein internes Format, in dem aktuelle Risiken, Vertragslücken und potenzielle Konfliktfelder transparent besprochen und verhandlungsseitig bewertet werden.
Rollen von Einkauf, Vertrieb & Produktion
Fazit: In einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit und volatiler Märkte ist es entscheidend, die eigene Verhandlungskompetenz nicht dem Zufall zu überlassen. Wer die Zusammenhänge zwischen Planung, Vertrag und Risiko frühzeitig erkennt und klug strukturiert verhandelt, gewinnt nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern auch unternehmerische Handlungsfreiheit. Unternehmen, die sich auf diese Weise aufstellen, berichten von gestiegener Resilienz, einer klareren Führung und einer besseren Verzahnung zwischen den Abteilungen.
Wenn Sie Ihre Verhandlungsfähigkeit schärfen möchten oder gezielt prüfen wollen, wie verlässlich Ihre Prozesse wirklich sind, empfehle ich Ihnen ein unverbindliches Erstgespräch. So erkennen wir gemeinsam, welche Stellschrauben Sie für mehr Sicherheit, mehr Handlungsspielraum und mehr Wirkung nutzen können.

Der Einkauf achtet darauf, kalkulierte Risiken des Sales-Teams mit der gesamten Lieferkette zu teilen, oder sogar gänzlich weiterzureichen
Checkliste für interne Projekt- und Auftragsmeetings: Absicherung und Vorausplanung
Diese Checkliste dient der strukturierten Vorbereitung und Risikoeinschätzung bei Projekt- oder Kundenaufträgen. Ziel ist es, bereits vor Beginn der Umsetzung sämtliche Eventualitäten durchzudenken, insbesondere den Worst Case und die Folgen möglicher Stornierungen, Verschiebungen oder Teilabnahmen. Die Bearbeitung erfolgt idealerweise im interdisziplinären Team (Einkauf, Vertrieb, Produktion, Controlling, Projektleitung).
1. Vertrags- und Auftragsklarheit
– Wie hoch stufen Wirtschaftsauskunfteien oder Bonitätsauskunfteien im Risiko ein?
– Liegt ein rechtsverbindlicher Kundenauftrag vor?
– Gibt es ein unterschriebenes Dokument mit klaren Mengen, Terminen und Abnahmeverpflichtung?
– Sind Zahlungsmodalitäten, Lieferbedingungen und Rücktrittsregelungen klar geregelt?
– Ist eine Rücktritts- oder Stornoklausel enthalten? Wenn ja: mit welchen Fristen und Kostenfolgen?
2. Abstimmung interner Planung mit Vertragsinhalten
– Entspricht unsere Produktions- und Beschaffungsplanung exakt dem vertraglichen Rahmen?
– Werden Materialien oder Leistungen bereits disponiert, obwohl keine Absicherung vorliegt?
– Gibt es ein internes Freigabesystem, das nur nach vertraglicher Klarheit die Umsetzung erlaubt?
– Ist das Projekt in unserer ERP-Logik als „gesichert“ oder „noch in Verhandlung“ gekennzeichnet?
3. Worst-Case-Analyse
– Was passiert, wenn der Kunde den Auftrag storniert?
– Welche Kosten sind bis dahin entstanden (Material, Löhne, Vorleistungen)?
– Was geschieht mit Halbfertigteilen, spezifisch bestellten Komponenten oder fertigen Produkten?
– Haben wir vertragliche Rücknahmerechte, Entschädigungsansprüche oder Kompensationsregelungen?
– Welche Abteilungen wären betroffen? Wie groß ist der Schaden operativ und finanziell?
4. Prüfung nach dem Worst Case
– Falls der Worst Case eintritt: Welche konkreten Folgeschritte sind vorgesehen?
– Ist die Situation durch vorhandene Rücklagen oder Versicherungen finanziell abgedeckt?
– Gibt es alternative Absatzkanäle oder Sekundärverwertungen für das Material/Produkt?
– Würde das Ereignis zu Liquiditätsengpässen führen oder ist es tragbar?
– Wurde im Vorfeld ein Risikobudget eingeplant, das gezielt diesen Fall absichert?
5. Kommunikation und Entscheidungsfreigabe
– Welche Führungsebene trifft im Krisenfall die finale Entscheidung?
– Gibt es vorbereitete Kommunikationsmuster (intern / extern)?
– Sind die betroffenen Teams über den Eskalationsplan informiert?
– Gibt es eine dokumentierte Handlungsempfehlung für „kritische Fälle“?
– Wird das Meeting mit einem klaren Freigabe- oder Stoppentscheid abgeschlossen?
Diese Checkliste sollte bei jedem kritischen oder größeren Projekt im Vorfeld durchgearbeitet werden. Sie ersetzt keine Rechtsberatung, schafft aber Klarheit, Risikotransparenz und Handlungssicherheit im Sinne einer professionellen Vorausplanung.
Call me +4915116779000